Das dritte Buch der hawaiianischen Autorin Hanya Yanagihara, „Zum Paradies“, kann jetzt schon zu den meist beachteten Werken des Jahres 2022 zählen. Sie entwirft drei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und sich doch immer wieder ähneln. Warum für mich hier weniger definitiv mehr gewesen wäre, erzähle ich euch in der Rezension.
Enthält Spoiler!
Triggerwarnung: Pandemie, Tod, Krankheit, Totalitarismus
Drei in eins
„Zum Paradies“ ist, wie schon Yanagiharas viel rezipiertes Buch „Ein wenig Leben“, mit knapp 900 Seiten ein ganz schöner Wälzer. Lasst euch jedoch nicht abschrecken, denn bei diesem Buch bekommt ihr sozusagen drei zum Preis von einem: Der Roman besteht aus drei Geschichten, die jeweils ein eigenes Buch sein könnten. Die einzelnen Stränge sind durch verschiedene Elemente verbunden, deren Sinn sich mir nicht immer ganz entschlossen hat. So tragen die Protagonist*innen in jedem Abschnitt dieselben Namen, sind allerdings nicht miteinander verwandt oder gar dieselben Figuren. Darauf muss man sich einlassen.
Zunächst geht es in eine alternative Version von Amerika, die 1893 angesiedelt ist. In den sogenannten Freistaaten ist Homosexualität die Norm, wobei nur weiße Personen den Status von Bürger*innen haben. Obgleich also eine Diskriminierungsform wegfällt, ist Rassismus an der Tagesordnung. Im Zentrum des Abschnittes steht David Bingham, Spross einer (einfluss-)reichen Familie. Er soll eine arrangierte Ehe, ein in den Freistaaten gewöhnliches Konzept unter reichen Personen, mit dem um einiges älteren Charles eingehen. Zwar lassen sich die ersten Gespräche zwischen den beiden gut an, doch dann trifft David auf einen schönen, aber mittellosen Musiklehrer mit Namen Edward, der die Welt des Erben aus den Angeln hebt. Davids Großvater, bei dem er nach dem Tod seiner Eltern aufgewachsen ist, ist damit so gar nicht einverstanden. Wir erfahren außerdem, dass David zu Anfällen und Obsessionen neigt, wodurch er nicht in der Lage ist, einen geregelten Beruf auszuüben. Und: Davids Eltern sind scheinbar während einer Epidemie ums Leben gekommen – die Krankheit wird nicht explizit benannt, es wirkt jedoch, als sei sie durch Flöhe übertragen worden.
Dort, bei Edward, war ein anderer Ort, einer, an dem er noch nie gewesen war, nach dem er aber, wie ihm bewusst wurde, sein ganzes Leben lang gesucht hatte.
Hanya Yanagihara: Zum Paradies, S. 217.
Der nächste Abschnitt spielt im Manhattan der 1990er Jahre. Auch hier steht ein David im Fokus, der eine Beziehung zu dem reichen, viele Jahre älteren Charles führt. Die beiden leben zusammen, aber David fühlt sich häufig, als sei er nur ein Anhängsel. Im Umkreis des Paares sterben immer mehr Männer, denn es grassiert die AIDS-Epidemie. Diese wird jedoch nicht als solche benannt, sie lässt sich allerdings durch die Beschreibung der Erkrankten und den historischen Kontext herausfiltern. Hinzukommt, dass er keinen Kontakt mehr zu seinem Vater Kawika, einem Abkömmling hawaiianischer Monarch*innen, hat. Eines Tages erhält er von diesem jedoch einen Brief, durch den wir erfahren, warum sich Vater und Sohn voneinander entfernt haben. Davids Vater ist beinah vollständig erblindet, lebt in einem Heim und ist auf ständige Pflege angewiesen. Abgesehen von der Beziehung zwischen Vater und Sohn geht es außerdem um die Kolonialisierung von Hawaii und der daraus entstehenden Spaltung der dort lebenden Bevölkerung. Ein Freund von Davids Vater, Edward, lehnt den Anschluss an die USA ab und will eine kleine Utopie namens Lipo-Wao-Nahele gründen. Während David und sein Vater dort zuerst gemeinsam mit Edward leben, wird schnell offensichtlich, dass das Projekt scheitern muss. Davids Vater ist Edward beinah willenlos ergeben und kümmert sich kaum um seinen Sohn, geschweige denn um sich selbst. Kawikas Mutter holt ihr Enkelkind zu sich und spätestens zu diesem Zeitpunkt beginnt die Entfremdung von Vater und Sohn.
Der letzten und längste Teil – er macht rund die Hälfte des Buches aus – findet in der Zukunft statt. Es ist 2093. New York ist eine Dystopie und wird von einem totalitären Regime geführt. Der Klimawandel hat Naturkatastrophen und Krankheiten verursacht. Diese Punkte spielen genau in die aktuellen Fragen und Ängste hinein, die viele von uns umtreiben. Das Leben der New Yorker*innen ist genau geregelt: Es gibt Essensmarken, betreute (sprich: überwachte) Freizeitangebote und abermals arrangierte Ehen. Außerdem wurden Bücher und andere Kunst weitestgehend verbannt. Aber lasst euch nicht täuschen: Auch in diesem System gibt es unterschiedliche Klassen, die sich beispielsweise an der Kleidung oder den Haaren ablesen lassen und beeinflussen, welche Zugänge man zu Wohnungen, Arbeit, Körperpflege, Nahrung und Kultur hat. Während der Kindheit der Protagonistin Charlie veranlasst die Regierung verschiedene Maßnahmen, um eine besonders schwerwiegende Krankheit einzudämmen – Ausgangssperre, Lockdown, Quarantänelager usw. Charlies Vater schließt sich aus diesem Grund einer Gruppe von Rebell*innen an, die mit Gewalt gegen die Maßnahmen vorgehen wollen. Dabei verliert er nicht nur sein Leben, sondern auch einen seiner Väter, wodurch Charlie und ihr Großvater Charles allein zurückgeblieben sind. All das erfahren wir aus der Retrospektive, indem Charles Briefe an seinen im Ausland lebenden Freund Peter sendet. Um ehrlich zu sein, ist es mir sehr schwergefallen, diesen Teil des Buches zu lesen und ich würde allen, denen dieses Thema zu nah geht, davon abraten, „Zum Paradies“ aktuell in die Hand zu nehmen.
Trotz all der Regulierungen sind die Menschen noch immer in der Lage, zu lieben, egal, ob diese Liebe erlaubt ist oder nicht (im dritten Teil ist Homosexualität strafbar). Yanagihara kreist damit auch um die Frage, was der Kern von Menschlichkeit ist. Genau in dieser Fähigkeit zur Liebe liegt die Hoffnung der Menschheit, ganz gleich, wie egoistisch und unersättlich sie sonst sein mag.
Konnte ich doch Liebe empfinden? War das, was ich immer für unerreichbar gehalten hatte, etwas, was ich die ganze Zeit verspüre?
Hanya Yanagihara: Zum Paradies, S. 691.
Dass Charlie, die als Kind an einem Virus erkrankte, weiblich ist, ist ungewöhnlich, denn alle anderen wirklich zentralen Figuren sind männlich. Die Krankheit, oder vielmehr die dagegen verabreichten Medikamente, haben sie verändert. Ihr sind nicht nur die Haare ausgefallen, sie hat auch Probleme, mit anderen Menschen zu interagieren sowie Emotionen zu zeigen und ist unfruchtbar. Einzig ihr Großvater Charles ist in der Lage, auf sie einzugehen. Gerade ihre Einschränkungen im Bereich der sozialen Interaktionen deuten auf eine Form von Autismus hin, was allerdings wieder ein wenig aufgehoben wird, da Charlie schließlich durchaus in der Lage ist, zu fühlen und mit Menschen zu interagieren.
Außerdem findet sich eine Binnenerzählung von zwei Brüdern, die aufgrund einer Krankheit nicht mehr das Haus verlassen können. Charles bringt den Jungen, die er übrigens nicht voneinander unterscheiden kann, Mitleid entgegen. Er fragt sich, wie die Eltern, insbesondere die Mutter, es mit sich vereinbaren können, die Jungen so leben zu lassen. Am Ende sterben die Brüder, Charles findet ihre Leichen im Garten. Er stellt sich vor, wie sie gestorben sind: „Dort standen sie Hand in Hand […], während sich ihre Münder voller Staunen öffneten und ihr Leben – dieses eine Mal – prachtvoll wurde, während es endete“ (S. 716). Eine Kritik daran, dass Überleben nicht über alles gehen sollte? Wirklich Stellung wird dazu nicht bezogen. Das ist ein Eindruck, der sich für mich durch das ganze Buch zieht: Es werden kleine Krumen ausgeworfen, über die man spekulieren kann. Natürlich ist diese Offenheit ein Kunstgriff, zugleich stellt sich jedoch die Frage, ob es sich die Autorin damit nicht zu einfach macht. Für mich hat sich dadurch ein Unbehagen aufgebaut, das mich jede Seite, jeden Satz des Buches hinterfragen lässt und beunruhigend ist.
Die verbindenden Elemente
Wie bereits geschrieben, existieren einzelne Elemente, die in allen drei Teilen vorkommen. Dazu gehören nicht nur Namen und Orte, sondern auch die Zentrierung von männlicher Homosexualität. In jedem Buch steht außerdem eine Epidemie mehr oder weniger stark im Fokus. (Familiäre) Beziehungen und Entfremdung spielen ebenfalls eine Rolle. Das zugrundliegende Thema sind Utopien beziehungsweise die Suche nach dem Paradies. Dieses Paradies kann für jede*n anders aussehen. Jeder Abschnitt endet damit, dass eine Figur einer anderen von ihrem persönlichen Paradies berichtet. Und so sind die jeweils letzten Worte stets „Zum Paradies“. Dazukommt eine Unsicherheit, die sich durch die jeweilige Gesellschaft zieht und durch den Zeitpunkt der Episoden verursacht wird. Wir lesen immer wieder, dass bald ein neues Jahrhundert bevorsteht. Es geht also um einen fundamentalen, zeitlichen Umbruch und die Frage, welche Entwicklungen dieser nach sich zieht. Was mir gut gefallen hat: Immer wieder schreiben die Figuren Briefe, wodurch die Erzählperspektive und der Stil aufgelockert werden.
Aber es gibt auch Unterschiede. Während die ersten beiden Teile überwiegend aus der dritten Person heraus erzählt werden – Briefe bilden hier eine Ausnahme -, existiert mit Charlie eine Ich-Erzählerin. Zunächst berichtet sie recht emotionslos. Aber mit der Zeit erhält sie einen immer tieferen Zugang zu ihren Emotionen. Im selben Maße steigern sich dadurch beim Lesen die Gefühle ebenfalls. Das ist stilistisch geschickt gemacht und für mich einer der Gründe, weshalb der dritte Teil der beste ist. Zusätzlich reisen wir in diesem Abschnitt immer wieder zurück in die Zeit, in der der Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit beschlossen wurden. Diese Abschnitte werden durch die Augen von Charles berichtet, der als junger Virologe maßgeblich an den Plänen zur Eindämmung beteiligt war.
Für mich war „2093“ der stärkste und zugleich erschütterndste Abschnitt des Buches. Vor allem die Briefe, die Charles an seinen Freund Peter schreibt und durch die wir lernen, wie sich das totalitäre Regime geradezu schleichend aufgebaut hat, sind herzzerreißend. Die Beziehungen zwischen Großeltern und Enkelkindern sind zwar ein dem ganzen Buch zugrundeliegendes Thema, aber das Gespann aus Charles und Charlie war ganz besonders.
Manchmal denke ich, irgendwo in diesem Haus ist ein Stück Papier mit den Antworten versteckt, und wenn ich nur fest genug daran glaube, wache ich in dem Monat oder dem Jahr auf, in dem ich erstmals auf Abwege geraten bin, nur dass ich diesmal das Gegenteil von dem tun werde, was ich getan habe.
Hanya Yanagihara: Zum Paradies, S. 730.
Was soll das alles?
Doch was möchte uns Yanagihara damit sagen? Wo genau liegt der Sinn dieser verbindenden Elemente – gibt es überhaupt einen? Der Plot wirkt stellenweise überladen, als habe die Autorin so viel behandeln wollen wie nur möglich. Zugleich fallen einige Aspekte hinten über, wodurch einerseits sehr viel passiert, andererseits aber einige Punkte nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen zustehen würde. Die Autorin lässt, obwohl sie detailreich erzählt, mindestens ebenso viele Details aus. Leser*innen müssen sich einiges selbst zusammenreimen und werden dabei oft allein gelassen.
Alle drei Abschnitte des Romans sind ein großes „Was wäre wenn?“. Es geht um kleine Entscheidungen, die einen großen Effekt haben – wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und dessen Kreise immer größer werden. Besonders deutlich wird dies im Fall von Charlies Großvater, der seine Entscheidungen rückblickend in Frage stellt. Zwar seien sie ihm zu dem entsprechenden Zeitpunkt richtig vorgekommen, aber in Anbetracht der Auswirkungen ist er sich da nicht mehr so sicher. Charles bereut seine Entscheidungen und wünscht, er hätte es geschafft, aus New York zu fliehen. Auf einmal war es dafür zu spät. Und erst im Rückblick ist ihm dies bewusst, denn wir können die Konsequenzen unserer Entscheidungen immer nur im Nachhinein wirklich kennen. Obwohl Charles stets das Richtige tun wollte, hat er am Ende dennoch versagt.
Eines Tages passiert etwas, vielleicht sogar etwas Unbedeutendes, […] und plötzlich begreifst du, dass du in Gefahr bist […]
Hanya Yanagihara: Zum Paradies, S. 746.
Nur ein winziger Flügelschlag
All das lässt sich unter dem Schmetterlings-Effekt subsumieren. Dieser besagt, dass wir nicht überblicken können, wie sich kleine Änderungen der Ausgangsbedingungen langfristig auf das ganze System auswirken. Unvorhersehbarkeit ist hier das Stichwort. Und diese Unvorhersehbarkeit ist besonders dann erschreckend, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen – wie Charles, dem es darum ging, Menschenleben zu retten. Unsere Entscheidungen können Auswirkungen auf unsere ganze Umgebung haben: Auf uns selbst, unsere Beziehungen, unser politisches System, die ganze Welt.
Krankheit verbindet das Ich untrennbar mit Fremden, und selbst wenn man an sie denkt, an diese Millionen von Menschen, mit denen man in der Stadt zusammenlebt, fragt man sich zwangsläufig, wann ihr Leben möglicherweise das eigene streifen wird […]
Hanya Yanagihara: Zum Paradies, S. 799.
Doch für mich stellt sich die Frage, ob alle Taten gleich starke Konsequenzen haben. So ist Charles in einer mächtigen Position. Haben seine Entscheidungen dadurch nicht mehr Gewicht? „Zum Paradies“ bildet Welten ab, in denen Unterdrückung herrscht und in denen bestimmte Figuren mehr Einfluss und Macht haben als andere. Sind die Konsequenzen ihrer Entscheidungen dann nicht viel größer? Im Umkehrschluss sind andere Figuren in weniger gehobenen Positionen den Umständen weitestgehend ausgeliefert. Dieses Ausgeliefertsein wird kaum thematisiert, stattdessen wird suggeriert, alle Taten hätten gleich starke Auswirkungen. Diese fehlende Problematisierung verblüfft, denn bereits zu Beginn des Romans wird deutlich, welchen großen Einfluss die Kategorie Klasse auf die jeweils abgebildete Gesellschaft nimmt.
Wir können das Paradies nie erreichen
Am Ende entsteht der Eindruck, dass letztlich sowieso alles egal ist, denn das Paradies, und das zeigen alle drei Abschnitte, kann nie erreicht werden. Auf das Chaos um uns herum haben wir keinen Einfluss, weil eben alles Einfluss hat und sich somit gegenseitig aufhebt. Das Paradies ist ein Wunsch, ein Nicht-Ort, nach dem die Figuren streben und von dem wir doch wissen, dass sie nie dort ankommen werden. Das ist eine logische Konsequenz, denn das gesamte Konzept eines Paradieses bezieht sich darauf, ein abgeschlossener Ort zu sein (nicht umsonst wird es traditionell von einer Mauer umfasst dargestellt) und dadurch ist das ausschließende Moment immer implizit vorhanden. Obwohl jeder Abschnitt ein offenes Ende hat, ist es relativ offensichtlich, was herauskommen wird. Besonders deutlich wird dies im Fall von David (1893), der sich wider besseren Wissens entscheidet, mit Edward fortzugehen, obgleich allen klar ist, dass Edward nicht das Beste für David im Sinn hat. Im Gegensatz zu Charles (2093), der tatsächlich nicht wissen kann, welche gravierenden Konsequenzen seine Entscheidungen nach sich ziehen werden, rennt David sehend Auges in sein Unglück. Kawika wiederum trifft irgendwann einfach gar keine aktiven Entscheidungen mehr, sondern lässt sich treiben, während er die Augen vor den Folgen verschließt. Alle drei Figuren eint, dass sie nichts Böses wollen: Sie möchten frei leben und lieben, in Charles‘ Fall anderen Menschen helfen.
Wir wollten eigentlich nicht, dass etwas passierte – wir wollten das Gegenteil.
Hanya Yanagihara; Zum Paradies, S. 420.
Zugegeben, Yanagiharas Buch entwickelt einen unglaublichen Sog, dem ich mich kaum entziehen konnte. Gleichwohl: Am Ende ist jedes Buch strukturell ähnlich aufgebaut, was einen stark repetitiven Charakter hat und eine große Vorhersehbarkeit befördert. Trotz der Leerstellen bleibt damit kaum eine Möglichkeit für überraschende Wendungen oder für Aspekte, die der Erzählung zuwiderlaufen. Mir hätte deshalb der letzte Teil vollkommen gereicht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das Buch darauf angelegt ist, eine große Wahrheit zu offenbaren – und diese schließlich nicht abliefert. All die Konstruktion, die Gesellschaftskritik, die Alternativ-Universen sind für mich leider überwiegend aufgeblasen. Weniger wäre in diesem Fall mehr gewesen. Zusätzlich ist für mich nicht der richtige Zeitpunkt für ein Buch, das Pandemien fokussiert, was natürlich eine persönliche (Nicht-)Präferenz ist. Es wirkt, als sei Yanagihara auf einen Zug aufgesprungen und hätte etwas konstruiert, was sich schlussendlich eben als genau das entpuppt: Ein Konstrukt, das einem Skelett ohne Haut und Herz gleichkommt.
Ich muss jedoch zugeben, dass ich vielleicht zu einem anderen Fazit gekommen wäre, hätte ich „Zum Paradies“ nicht zum jetzigen Zeitpunkt gelesen. Mir ist völlig klar: „Zum Paradies“ gehört dieses Jahr zu den Büchern, die die größten Kontroversen auslösen werden und ich freue mich auf die Diskussionen darüber. Und obwohl es für mich nicht das Highlight war, das ich fast schon erwartet habe, hat das Buch unglaublich viel in mir ausgelöst: Denkprozesse, Wut, Angst, Trauer, Ungläubigkeit, Spannung. „Zum Paradies“ ist keine einfache Kost, die man mal eben wegsteckt. Für mich gibt es einige schwierige Punkte an dem Werk, aber ich finde es toll, wenn Literatur vermag, wirklich etwas in einem zu bewegen! Dies ist kein Buch, das man nach dem Lesen einfach wieder beiseite legt und vergisst. So wird „Zum Paradies“ zwar nicht zu einem Lieblingsroman, aber doch zu einem der Bücher, die mich am meisten angeregt haben.
Eine weitere ausführliche und kritisch-reflektierte Besprechung unter dem Titel „Überhitzte Luftschlösser“ ist bei Sandra zu finden.

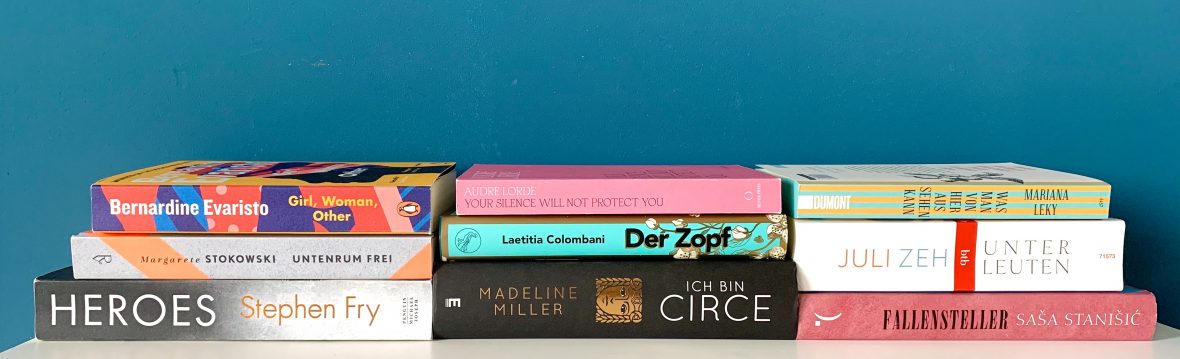
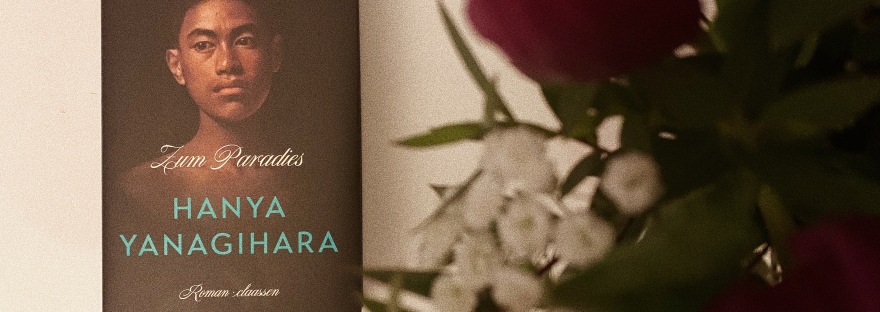
Ein Gedanke zu „Zum Greifen nah und doch unendlich weit entfernt“